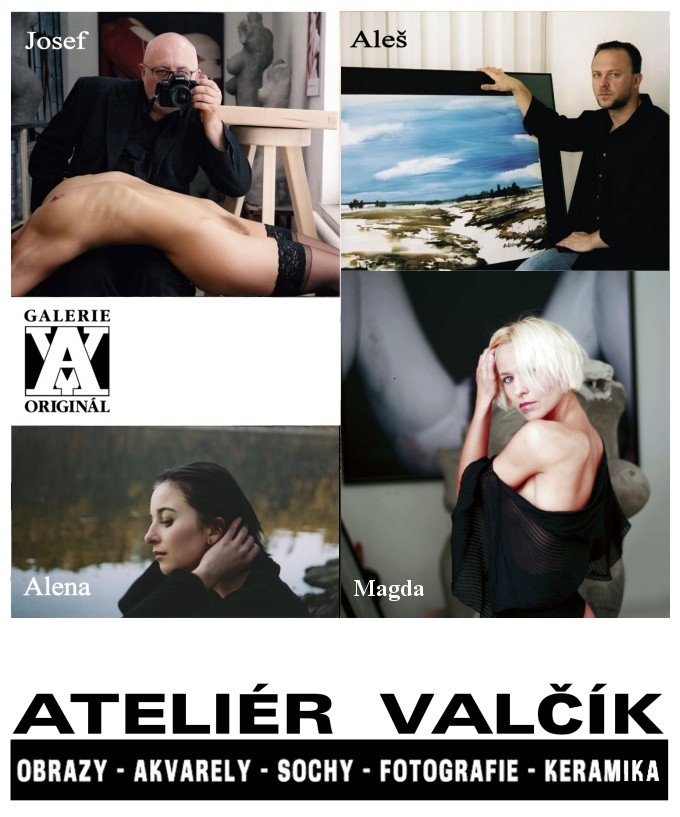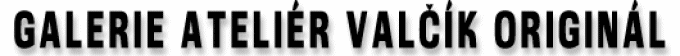|
Zeit
und Zeitlosigkeit des Atelier Valèík
Einmal habe ich über das Atelier Valèík geschrieben, dass es
zuallererst eine Familie ist. Damit habe ich nicht nur die Tatsache
gemeint, dass es um einen Vater und seine Kinder geht, also um eine
Familie, für die das Malen, Fotografieren, die Produktion von
Statuen, Gebrauchsgegenständen, Covers oder Kalendern seit nun fast
12 Jahren zum Leben und dessen Sinn geworden ist. Dafür könnten wir
in der Geschichte viele ähnliche Beispiele finden und es gibt keinen
besonderen Grund dies zu betonen. Wenn ich das trotzdem getan habe,
und nicht nur einmal, dann meinte ich damit, dass das Wort Familie
in diesem Fall etwas Zeitloses, Naturhaftes, genauer Blutsverwandtes,
aber auch etwas Institutionelles, Geschichtliches und daher
Zeitliches in sich vereint. Man könnte einwenden, dass das nicht nur
für Malerfamilien gelte, sondern für alle Familien überhaupt, und
man hätte nach unseren gängigen Vorstellungen auch Recht damit. Als
ich mich auf die Institution der Familie berufen habe, hatte ich
keine rechtlichen oder gesellschaftlichen Normen oder politische
Vorstellungen im Sinn, sondern die einfache Tatsache, die nur für
wenige Künstlerfamilien gilt. Im Atelier Valèík bedeutet die Familie
nicht nur Verwandtschaft, sondern auch Malerschule, Werkstatt,
Künstlergilde und Atelier in einem. Ich erwähne es, weil ich aus
dieser Vielschichtigkeit der Familie die besonderen
Erscheinungsformen von Zeit und Zeitlosigkeit des Atelier Valèík
herleiten will. Wenn ich über die Zeit schreibe, dann will ich es
nicht auf die Geschichten über gute, schlimmere und schlimme Zeiten
einschränken, so wie wir alle sie individuell erleben und zweifellos
auch die einzelnen Mitglieder des Atelier oder das Atelier selbst.
Ebenso beabsichtige ich keine Chronologie des Atelier Valèík zu
liefern von seiner Gründung im Jahre 1993 bis zu der jüngsten
Ausstellung des Jahres 2005. Es wäre sicher eine stattliche und
aufschlussreiche Aufstellung. Aber ich will nicht die „äußere“
Geschichte des Atelier Valèík, seine Wandlungen, die Verlegungen
seines Sitzes oder die gesellschaftlichen Ereignisse rekonstruieren,
welche auf das Atelier Valèík einwirkten bzw. die es selber
hervorrief. Auch darüber könnte man so manches schreiben und es
würde sich sicher lohnen, für eine Weile Historiker zu werden und
die Archive zu durchforsten. Es würde sich zumindest bestätigen,
dass das Atelier Valèík nichts Fiktives oder Virtuelles ist, sondern
eine Künstlergruppierung, die nicht nur ein Bestandteil der
tschechischen, mährischen und mitteleuropäischen Gemeinschaft ist,
sondern auch etwas, was Aufmerksamkeit auf sich zieht, Interesse
hervorruft, positive und widerspruchsvolle Reaktionen herausfordert
und damit seine Ungewöhnlichkeit kraftvoll bestätigt. Mit dem
Begriff der Zeit will ich auch keine Spekulationen über Herkunft,
Einflüsse, Parallelen, kurz über die innere Geschichte ihres
Schaffens einleiten, auch wenn sich hier ebenfalls viel Gewichtiges
zeigen würde. Es würde wahrscheinlich zu Tage kommen, dass sich das
Atelier Valèík in der Zeit des Eindringens der Medien und
Installationen eher „unmodisch“ und wohl auch „antiprofessionell“
den klassischen Gattungen des Malens widmet, so wie wir sie noch am
Anfang des vorigen Jahrhunderts beobachten konnten. Wir würden
feststellen, dass das Atelier Valèík sich mit gegenständlicher
Malerei und mit Gattungen befasst, die gegenwärtig eher auf dem Feld
der naiven als der avantgardistischen Kunst anzutreffen sind. Solche
Überlegungen, so interessant sie auch sein könnten, will ich jetzt
nicht weiter ausführen. Im Gegenteil: Über die Zeit und die
Zeitlosigkeit will ich etwas im Hinblick auf die einzelnen Teile und
Schaffensmethoden des Atelier Valèík schreiben. Zum Beispiel darüber,
dass Josef in dieser Gruppe den zeitlichen und historischen Faktor
verkörpert. Nicht nur aus dem Grund, weil er das Atelier gegründet
hat, sondern vor allem deshalb, weil er ständig unzufrieden, ständig
auf der Suche ist. Solche Motivationen und Charakteristika erfordern
jedoch eine nähere Erklärung. Allein schon deswegen, weil das Gefühl
der Unzufriedenheit und des Suchens auch die anderen Mitglieder des
Atelier teilen. Josef Valèík projiziert jedoch gleich von Anfang an,
und darin unterscheidet er sich von seinen Kindern, die
Unzufriedenheit und das Suchen nach außen, in nicht nur technische
Experimente, in seine Grenzgänge zwischen Kunstarten und Gattungen,
von Gemälden über Fotografien bis zu Skulpturen. Aleš und Magda
kehren ihre Unzufriedenheit und Suche nach innen, konzentrieren sich
auf kaum merkbare, für sie jedoch wesentliche Änderungen des Malens
in schwerpunktmäßig einem Medium, ja beinahe überwiegend in einer
Gattung. Zeit und Zeitlosigkeit zeigen sich im Schaffen der
einzelnen Künstler des Atelier auch darin, welchen zeitgebundenen
und zeitlosen Gattungen sie sich widmen. Wenn Josefs Porträts, Akte,
Blumensträuße oder auch symbolische Bilder versuchen Veränderungen
festzuhalten, dann gilt dasselbe auch für Alešs Marinen und
Landschaftsbilder mit Wäldern, Wasserflächen und Küsten; für Magda
jedoch viel weniger, denn sie malt mit zielbewusster Beharrlichkeit
Stillleben und schmale Ausschnitte von Landschaften ohne bemerkbare
Anwesenheit des Menschen. Zeit und Zeitlosigkeit haben in den Werken
von Josef, Magda und Aleš noch eine, zwar mit dem Gesagten verwandte,
aber sich davon unterscheidende Dimension: Es ist die Zeit bzw.
Zeitlosigkeit der Malmethode, der Handschrift, der verwendeten
Technik. So unterscheiden sich die zeitgebundene gestische Malerei
oder die leidenschaftliche Handschrift der Bilder und Skulpturen
Josefs, die zu einer Zeitlosigkeit des Symbols tendieren, wie sich
die fließenden Aquarellbilder von Aleš unterscheiden, welche die
Vergänglichkeit der Zeit widerspiegeln, die Wandelbarkeit des sich
ständig Wiederholenden, Zeitlosen. Ebenso differieren die Ölbilder
Magdas, welche die Zeitlosigkeit der Geometrie und die
zeitgebundenen vibrierenden farbigen Punkte miteinander verknüpfen.
Die Zeit und die Zeitlosigkeit bilden im Atelier Valèík jene
charakteristische Einheit der Unterschiede, die wohl kaum zu sehen
wäre, wenn das Atelier Valèík nicht eine Familie wäre. Aus diesen
inneren Zusammenhängen erklärt sich auch das immer wiederkehrende
Ringen des Atelier Valèík, die periodischen Verwandlungen der vier
Jahreszeiten, deren kritische Punkte Zeit und Bewegung sind, im
Medium der Malerei festzuhalten.
Doz. PhDr. Marian Zervan, PhD. (1952) ist Theoretiker und
Ästhetiker der Kunst und der zeitgenössischen Architektur. Er
schrieb Bücher über sakrale Ikonographie, ist Kurator von
Ausstellungen über die slowakische Gegenwartsarchitektur im In- und
Ausland, für die er umfangreiche Studien in die Ausstellungskataloge
verfasst hat. Er wirkte als Dozent an der Fakultät für Architektur
der TU Bratislava, gegenwärtig ist er auch Dozent an der Hochschule
für bildende Kunst in Bratislava.
|